Dreieck
Den Rhythmus unterbrechen: Überlegungen zu kollektiven Forschungsprozessen im Seminarkontext
Im Gespräch blicken wir zurück auf ein gemeinsames Seminar zum Zusammenleben unterschiedlicher Lebensformen im Kontext Schule und den mit Studierenden entwickelten, kollektiven Forschungsprozess. Entlang kleiner Momentaufnahmen eines Labortags entwickeln wir drei Reflexionsstränge: Verschieben des Rhythmus, das Muster übersetzen und Beziehungsweisen zwischen Praxis und Theorie erforschen. Edition #2
Welche Rolle spielen Konvivialität, Reziprozität und Beziehungsweisen in der Schule? Diese drei Begriffe bildeten im Frühjahr 2023 den Ausgangspunkt für eine kollaborative Forschung zum Zusammenleben unterschiedlicher Lebensformen im Kontext Schule. Gemeinsam mit Studierenden des Instituts für performative Praxis, Kunst und Bildung (HBK Braunschweig) fingen wir im Rahmen des gemeinsamen Seminars an, das Zusammenleben unterschiedlicher Lebensformen im Kontext Schule künstlerisch zu erforschen. Entlang der Begriffe Konvivialität, Reziprozität und Beziehungsweisen haben wir versucht, alternative Wissensformen mit künstlerischen, edukativen sowie künstlerisch-edukativen Methoden und Herangehensweisen zu verknüpfen. Uns interessierte, wie vorgegebene Rhythmisierungen in Bewegung gebracht und unterbrochen werden können, welche künstlerischen Übersetzungen wir für bestehende Muster (er-)finden könnten und wie die Beziehungsweisen zwischen Praxis und Theorie sichtbar und verhandelbar werden können.
Im folgenden Wintersemester wurden die Ideen und Ansätze in einem weiteren Seminar vertieft und mündeten im Februar 2024 in einem Labortag in den Räumen der Spore Initiative e.V.1 in Berlin Neukölln. Eingeladen waren Lehrpersonen, Künstler*innen, Kunstvermittler*innen, Studierende und Wissenschaftler*innen.
Im Gespräch blicken wir aus unserer Position als Dozent*innen und vor dem Hintergrund der geteilten langjährigen Praxis als Kulturagentinnen im Programm Kulturagenten für kreative Schulen Berlin zurück auf das gemeinsame Seminar und den kollektiven Forschungsprozess. Entlang kleiner Einblicke in Momentaufnahmen des Labortags entwickeln wir drei Reflexionsstränge: Verschieben des Rhythmus, das Muster übersetzen und Beziehungsweisen zwischen Praxis und Theorie erforschen.
 Abb. 1 Raumansicht Labortag Spore Initiative e.V., 2024
Abb. 1 Raumansicht Labortag Spore Initiative e.V., 2024
Im Gespräch
Annika Niemann (AN): Nachdem wir im ersten Seminarteil die Hochschule selbst auf Formen des Zusammenlebens in den Blick genommen haben, war der Ausgangspunkt des zweiten Semesters eine Hospitation an zwei Berliner Schulen, die wir aus unserer Praxis als Kulturagentinnen kannten. Was fällt den Studierenden auf, wenn sie die Schulen betreten? Was sehen Menschen, die selbst vor nicht allzu langer Zeit aus einer eigenen schulischen Erfahrung herausgetreten sind und bald als Lehramtsstudierende wieder und in neuer Rolle in das System Schule eintreten? Welche Fragen stellen sie sich und den Lehrpersonen? Welche Versuchsanordnungen können daraus folgen? Was können und wollen die Studierenden der Praxis an Schule zurück- oder als Impuls hineingeben? Aus diesen Fragen heraus ist dann der Labortag in der Spore Initiative entlang von zwei künstlerischen Impulsen entstanden.
Silke Ballath (SB): Einmal ein Silent Walk, entwickelt von Philipp Kapitza, Le Thuc Anh Mai, Lina Rabe und Wenke Topola. Der andere Impuls war ein von Elsa Feulner, Dori Yuna Lonia Förster, Jakob Klukas und Hannah Neuhaus erarbeiteter Parcours, eine Art Stationenarbeit, wo zum Thema Sorge gearbeitet wurde. Sie haben die Teilnehmenden eingeladen, sich auf einem performativen Spielbrett mit unterschiedlichen Stationen zu bewegen und einzubringen.
 Abb. 2 Einladung zum Silent Walk, Labortag Spore Initiative e.V., 2024
Abb. 2 Einladung zum Silent Walk, Labortag Spore Initiative e.V., 2024
AN: Ich versuche kurz zu rekonstruieren, wie die Idee zu dem Silent Walk entstanden ist: Wir waren zur Hospitation in einer Gemeinschaftsschule in Berlin Mitte zu Gast. In den anschließenden Erzählungen und Reflexionen der Studierenden tauchte immer wieder das Wort Atemlosigkeit auf. Dieser extrem beschleunigte Rhythmus im Kontext Schule, der kaum Momente des Innehaltens ermöglicht. Es herrscht das Gefühl vor, dass man von Projekt zu Projekt, von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde rennt. Natürlich versucht die Schule, Projekte und Erfahrungsräume nachhaltig zu implementieren. Aber das Gefühl des Getrieben-Seins und der Atemlosigkeit hat die Studierenden beschäftigt. Wenn man die Schule als Organismus denkt: Wo gerät er außer Atem? Wodurch verschiebt sich gegebenenfalls der Rhythmus? Und wie kann man künstlerisch darauf einwirken? Diese Beobachtungen und Fragen führten dann zum Format Silent Walk, als eine Strategie, diesen Rhythmus zu unterbrechen und eine Pause einfach mal auszuhalten. Am Labortag kamen die Lehrpersonen direkt nach solch einem gehetzten Schultag und aus einer ganz dichten Taktung an einen Ort, an dem dann einfach erstmal eine Stunde lang nicht gesprochen wurde und scheinbar „nichts“ passierte. Diese Form von Unterbrechung ist ein Element, das ich spannend finde. Wie können Gewohnheiten unterbrochen werden, um etwas sichtbar, spürbar und erfahrbar zu machen? An demselben Tag war beispielsweise an einer der beteiligten Schulen ein Gewaltvorfall passiert. Da kamen also Lehrpersonen, die gerade die entsprechenden Konflikte und pädagogischen Herausforderungen im Kopf hatten, und fanden sich dann in einer Schweigesituation wieder. Das war natürlich ein extremer Kontrast.
Das Verschieben des Rhythmus
SB: Dieses Verschieben des Rhythmus ist meines Erachtens ein grundlegendes Prinzip unserer jeweiligen Praxen. Zunächst, um eine erste Aufmerksamkeit zu entwickeln für Themen, Kontexte und Diskurse. Sicher auch, um Sichtbarkeit herzustellen. Vor allem aber, um die Vielstimmigkeit dieser Diskurse, Kontexte und Themen abzubilden und einen Austausch zu eröffnen. Gayatri Chakravorty Spivak spricht zum Beispiel davon, dass mit dem double bind eine nicht offengelegte Aporie und eine widersprüchliche Anweisung offengelegt werden kann. Sie sagt: „In the contemporary context, we can call this the double bind of the universalizability of the singular, the double bind at the heart of democracy, for which an aesthetic education can be an epistemological preparation, as we, the teachers of the aesthetic, use material that is historically marked by the region, cohabiting with, resisting, and accommodating what comes from the Enlightenment. Even this requires immense institution-changing initiatives, thwarted by the bureaucratic spirit accepted above and below. And yet, there is ,the good teacher’, ,the good student’, on the way to collectivity. Doubt and hope” (Spivak 2012/2013: 4; Herv. S.B.). Dabei hebt sie hervor, dass sich diese unauflöslichen Widersprüche als Universalisierbarkeit des Singulären in jede Arbeit entlang ästhetischer Erziehung einschreiben, da das Material, aus dem eine Zusammenarbeit entsteht, historische Einschreibungen, Ausschlüsse und Markierungen enthält. Spivak schlägt daher vor, das double bind zu spielen, um handlungsfähig zu bleiben. Mit dem Silent Walk ist der Alltagsrhythmus unterbrochen worden. So jedenfalls haben es die Menschen, die daran teilgenommen haben, beschrieben. Sie haben es zum Teil als Geschenk und als Möglichkeit des Luftholens skizziert, aber auch als Raum, in dem die Aufmerksamkeit auf hegemoniale Ungleichheitsverhältnisse geschärft wird. Und du hast in einem gemeinsam verfassten Beitrag für KuBi Online das aktive Zuhören als eine verkörperte Praxis und Voraussetzung für das Miteinander-in-den Dialog-Treten beschrieben (vgl. Ballath/Niemann 2025). Heißt das, dass innerhalb bestehender Rhythmisierungen keine Dialoge im Sinne der rassismuskritischen Pädagogin und Aktivistin bell hooks (vgl. hooks 1994) oder des Pädagogen Paulo Freire (vgl. Freire 1981) eröffnet werden können?
AN: Ich denke, dass diese Rhythmisierungen zunächst ins Bewusstsein rücken müssen, um dann in einen Dialog treten zu können. Vielleicht liegt ja schon im Bewusstmachen selbst ein Moment des Aus-dem-Takt-Bringens (vgl. Ballath/Niemann 2025). In dem Moment, in dem mir etwa die Stundentaktung eines Schultages als eine gewaltvolle Struktur vor Augen tritt, liegt schon das Potenzial, den Takt zu verschieben. Und sei es nur um Bruchteile. Selbst minimale Verschiebungen im Stundenplan, um beispielsweise ein künstlerisches Projekt zu realisieren, erleben oft einen enormen Widerstand und sind für viele beteiligte Schulakteur*innen ein Kraftakt. Eben weil hier die Machtverhältnisse, in die schulische Praxis eingebunden ist, zutage treten.
SB: Entlang einer anderen oder neuen Rhythmisierung – und das kann mittels künstlerisch-edukativer Projekte passieren – zeigen sich also Handlungsmuster, Haltungen und Selbstverständnisse, die bislang nur an der Oberfläche geschlummert haben. In gewisser Weise entspricht das den Überlegungen dazu, dass mit künstlerisch-edukativen Praxen Unterbrechungen hervorgerufen, die Aufmerksamkeit verschoben und Perspektiven ergänzt werden können.
Ich bin in meiner Forschung zum Kulturagent*innenprogramm2 beispielsweise von einem Zweifel ausgegangen, den ich in der Praxis als Kulturagentin erlebt habe und der sich in diesen vielfältigen Überlagerungen eines „unüberprüften Universalismus“ (Spivak 2008: 41) abgezeichnet hat. Erst im praktischen Erproben dieser Widersprüche – in diesem Spiel zwischen Theorie und Praxis, zwischen Forschung und Kulturagent*innenpraxis – habe ich erlebt, wie sich meine Position und mein Selbstverständnis als Kulturagentin und als Forscherin verschoben haben. Mir hat diese Denkfigur des double binds und des Spieles sehr geholfen, meine Zweifel einzuordnen und mich mit meiner Praxis als Kulturagentin und als Forscherin zu verorten. Mit den postkolonialen Theoretiker*innen María do Mar Castro Varela und Leila Haghighat möchte ich daher anschließen: „Den double bind lernen bedeutet schließlich, auch die Widersprüche ertragen zu lernen, ohne die eigene Position zu verbergen” (Castro Varela/Haghighat 2023: 17; Herv. i. O.). Sie weisen darauf hin, dass der Wunsch des Verschiebens des Rhythmus auch bedeutet, die eigene Perspektive als Teil eines „unüberprüften Universalismus“ zu erkennen, der eben mit einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung einhergeht. Es muss also einbezogen werden, dass die Bedingungen der Teilnahme auf ungleichen Verhältnissen und Voraussetzungen beruhen. Die katalanische Philosophin Marina Garcés stellt dem „unüberprüften Universalismus“ die Vorstellungskraft als Möglichkeit einer Verschiebung des Blickwinkels entgegen. Und mit Bezug auf Spivak beschreibt sie die Vorstellungskraft als Werkzeug, „das den anderen und einen selbst anders macht. Man könnte sie auch das Werkzeug der Entfremdung nennen, […]. Die Vorstellungskraft desorganisiert das rein adaptive Lernen, aber sie ist nicht willkürlich, weil sie fremde Existenzen einbezieht und zusammensetzt. […] Deshalb ist die Vorstellungskraft die Grundlage des Zusammenlebens” (Garcés 2022: 211–212). Was bedeutet diese Überlegungen, Beispiele und Theorien in Bezug auf den Labortag? – Ist es möglich, durch das Produzieren von Brüchen in die bestehenden Kontinuitäten von Strukturen, Kontexten, Routinen und Formatierungen einzugreifen, um dominantes Wissen und bestehende Ungleichheitsverhältnisse offenzulegen?
Das Muster übersetzen
AN: Ich denke, dass dieses Offenlegen ein erster Schritt ist. Das ist am Labortag auf unterschiedlichen Ebenen gelungen. Ich frage mich, wie dieses Offenlegen, dieses Bewusstmachen dann zu einer tatsächlichen Verschiebung der Alltagspraxis führen kann. Diese Prozesse dauern oft sehr lange und sind nicht unbedingt sichtbar. Mir gefällt das Bild der Plattentektonik: Eine minimale Verschiebung löst vielleicht an einem ganz unerwarteten Ende zu einer ganz unvorhergesehenen Zeit ein kleines Beben aus und lagert sich in den Sedimenten schulischer Erfahrungen ab. Ein Labortag kann nur ein Brennglas sein. Er birgt die Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen, die sich dann vielleicht – hoffentlich – mitträgt in den Schulalltag und hilft, hier Dinge und Prozesse anders wahrzunehmen und ein Bewusstsein für sie zu entwickeln. Gerade diese Frage der Übersetzung – da mündet die Reflexion einer Hospitationserfahrung in eine künstlerische Versuchsanordnung, die sich wiederum in die Schule zurückspielt –, also diese Übertragungen zwischen den Räumen interessieren mich. Die Schaltstelle für diese Übertragungen sind für mich die Gespräche und das gemeinsame Drehen und Wenden aus verschiedenen Richtungen und mit unterschiedlichen Menschen. Deshalb war die Konstellation der Menschen am Labortag in der Spore Initiative wichtig. Eben weil nicht nur die Lehrpersonen eingeladen waren, sondern auch Theoretiker*innen, Wissenschaftler*innen, Künstler*innen, Vermittler*innen und Studierende, die jeweils aus unterschiedlichen Perspektiven und Kontexten auf die gemeinsam gemachte Erfahrung schauen konnten.
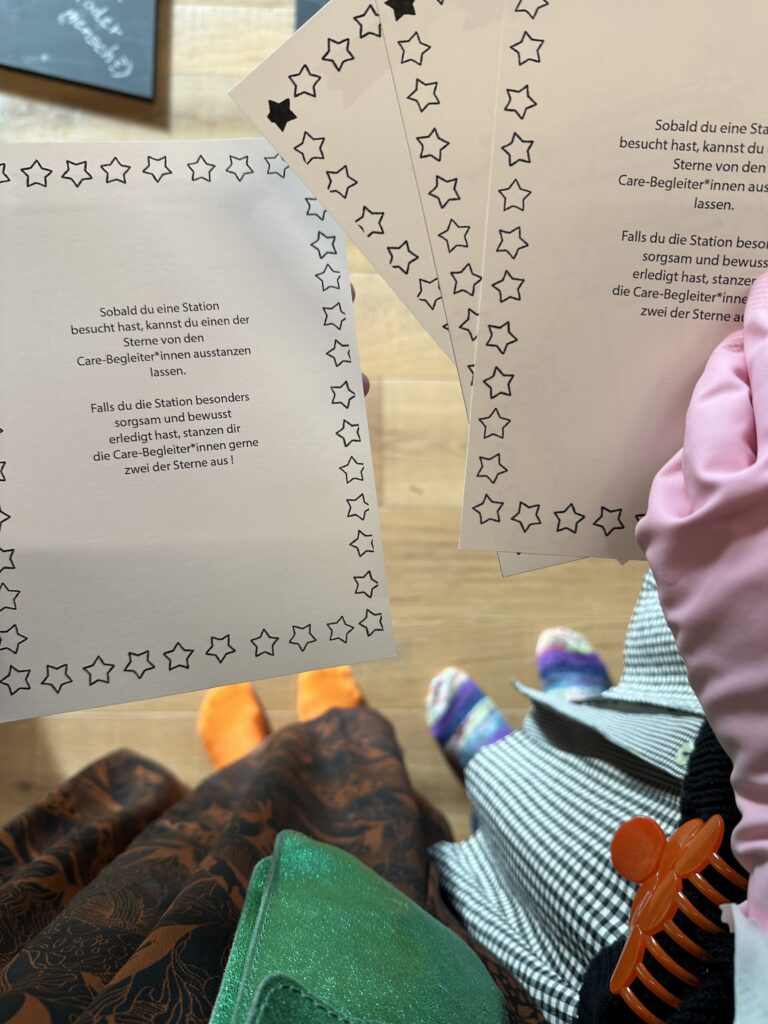 Abb. 3 Einladung Stationen, Labortag Spore Initiative e.V., 2024
Abb. 3 Einladung Stationen, Labortag Spore Initiative e.V., 2024
SB: Der Übersetzungsprozess zwischen Hospitationserfahrung, dem künstlerisch-edukativen Versuchsaufbau am Studientag und dem situierten Wissen der eingeladenen Gäst*innen hat viel mit dem Aufbau von Vertrauen zu tun; mit dem Aushandeln von unterschiedlichen Perspektiven, dem Zuhören und Sich-bewusst-Werden. Erst dann, wenn ein Bewusstsein entwickelt worden ist, ist es möglich in Bewegung zu kommen und darüber nachzudenken, wie beispielsweise der Silent Walk für deine Kollegin zu einer Möglichkeit an ihrer Schule werden könnte, um im Gespräch zu bleiben. Zunächst ganz basal: Ist der Silent Walk vielleicht ein Ausgangspunkt dafür, um überhaupt wieder ins Handeln zu kommen, bzw. um sich eine Alternative zu der bestehenden Praxis vorstellen zu können? Und was braucht es, um einen (Aushandlungs-)Raum zu eröffnen, um aufzugreifen und zu identifizieren, was der nächste Schritt sein könnte? Garcés formuliert beispielsweise: „Sich etwas vorzustellen bedeutet, sich in einen Schwebezustand zu versetzen, um sich mit denen verbinden zu können, die uns fremd sind. Sich etwas vorzustellen bedeutet, Platz zu schaffen für alles, was noch nicht ist, und für diejenigen, die noch kommen werden. Vorstellungskraft ist also eine Voraussetzung dafür, das Dasein in seiner ganzen Fremdheit und Disproportionalität anzunehmen” (Garcés 2022: 81). Denn um diesen nächsten Schritt benennen zu können, muss ja eine Form der Übersetzung stattgefunden haben. Das Spielen dieser Widersprüche als befreiende Position zu erleben, ihre Umkehrung als Möglichkeit zu praktizieren, bedeutet mit Garcés, sich zu erinnern. Sich erinnern, so schreibt sie, „heißt, sich etwas vorzustellen. Erinnerung bedeutet, sich das Bild einer Sache, einer Person, einer Idee oder einer Empfindung zu vergegenwärtigen, die nicht da ist und die wir aus irgendeinem Grund, ob wahr oder nicht, in die Vergangenheit setzen. Genauso können wir uns vorstellen, was nie geschehen ist oder was eines Tages geschehen wird. Die Vorstellungskraft verbindet also das, was ist, mit dem, was nicht ist, sie verbindet das, was wir wissen, mit dem, was wir nicht wissen, sowie die verschiedenen Dimensionen der Zeit untereinander” (Garcés 2022: 209–210). Figuren, wie die Kulturagent*in können dabei unterstützen, die Imagination zu trainieren und gemeinsam mit weiteren Akteur*innen zu aktivieren sowie einen Raum dafür zu eröffnen. Sie schafft Momente der Inspiration, lädt ein, genau dahin zu gucken, wo es kneift, zwickt und weh tut. Sie unterstützt jedoch auch dabei, den nächsten Schritt zu machen und einen Handlungsbedarf in eine künstlerisch-edukative Intervention zu übersetzen.
AN: Die Künstlerin und Bildungspraktikerin Juliana dos Santos spricht von Vorstellung als einer Handlung (vgl. Santos/Paula Souza 2021: 78–79). Anders als das Träumen, das im Schlaf passiert, erfordert es harte Arbeit, Übung, Praxis, andere Wege und Formen des Zusammenlebens zu imaginieren.
SB: Mit Garcés funktioniert das dann, wenn das Verhältnis zwischen Zeit und Erinnerung in den Blick gerückt wird. Zeit ist im Rahmen des Lehr- und Lernverhältnisses immer ein regulierender Faktor, der meist das Produkt vor den Prozess stellt. Sie formuliert dazu: „Die Erfahrung des Übergangs, des Weges und der Verwandlung durch das Lernen wird ersetzt durch die Erfahrung der Abfolge von in Etappen organisierten Momenten, Phasen und Spielen, die sich gegenseitig aufheben” (Garcés 2022: 208–209). Die Relation von Zeit und Erinnerung spielt insofern eine wesentliche Rolle bei dem Reaktivieren der Vorstellungskraft. Garcés erläutert dies wie folgt: „Die Vorstellungskraft verbindet also das, was ist, mit dem, was nicht ist, sie verbindet das, was wir wissen, mit dem, was wir nicht wissen, sowie die verschiedenen Dimensionen der Zeit untereinander. Es ist merkwürdig, dass eine so machtvolle Tätigkeit unseres Geistes in unserer Kultur so wenig wertgeschätzt worden ist. Oder vielleicht ist das gerade deshalb so, weil sie in der Lage ist, auf freie Weise Verbindungen und Beziehungen herzustellen” (Garcés 2022: 209–210).
AN: Ja, davon bin ich überzeugt. Wenn es auch darum geht, Strukturen zu schaffen, die eine künstlerische Praxis im Schulalltag etablieren, dann sind diese gemeinsamen Erfahrungsräume eine Grundvoraussetzung. In einer der Kulturagentenschulen, die ich begleitet habe, ist es das Fach Lernwerkstatt, in dem ein ästhetisch forschendes Lernen verankert werden sollte. Wir haben dann schnell festgestellt, dass viele Lehrpersonen, die das Fach unterrichten, selbst kaum eigene Erfahrung mit ästhetischer Forschung oder Berührungspunkte mit künstlerischen Ausdrucksformen hatten. Daraufhin haben wir ein kleines Labor angeboten, in dem die Lehrpersonen unterschiedliche künstlerische Erfahrungsmöglichkeiten hatten, die wir auf das „Forschungsfeld“ Schule angewendet haben. Eine Gruppe von Lehrpersonen hat etwa in Begleitung einer Tänzerin das Schulgebäude ertanzt und so körperlich und über Bewegungen eine neue Beziehung zur Architektur und zu den Wegen, die tagtäglich beschritten werden, aufgenommen. Eine andere Gruppe hat installativ auf das Schulgebäude reagiert und die Zwischenzonen und Aufenthaltsräume durch kleine Materialeingriffe räumlich markiert. Im Fotolabor wurden alltägliche Sprechrituale im Unterricht in Bilder übersetzt und so ganz neu lesbar. Solche kleinen Verschiebungen führen dazu, den Schulalltag anders zu betrachten und kleine Transformationen zu initiieren. Die verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen selbst auszuprobieren und miteinander zu teilen und zu diskutieren war eine hilfreiche Grundlage, um dann gemeinsam ins Gespräch zu kommen, wie künstlerisches Forschen in der Lernwerkstatt mit Schüler*innen zur Anwendung kommen kann. In diesem Beispiel tritt die künstlerische Praxis im Schulkontext nicht in projekthafter Form in Erscheinung, nicht als Momentum, in dem ein Thema über künstlerische Strategien aufgegriffen und bearbeitbar wird, sondern wo die Lehr- und Lernformate, wo der Unterricht selbst neu befragt und imaginiert wird.
Beziehungsweisen zwischen Praxis und Theorie erforschen
SB: Du hast gerade von Erfahrungsraum gesprochen, verbunden mit der Ebene der Reflexion. Ich denke, dass damit deutlich wird, dass Übersetzungsprozesse immer etwas mit Reflexion zu tun haben und mit den unterschiedlichen Dimensionen von Reflexion. Daran lässt sich anschließen: Was braucht es, damit sich zwischen Erfahrung und Reflexion etwas verschiebt? Was braucht es, damit ich überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickeln kann, dass ich gerade irritiert war? Und ist die Irritation vielleicht auch okay, weil sich gerade etwas in mir verschiebt? Für uns war wichtig, dass die Forschung zu diesem Projekt sowohl unterschiedliche Übersetzungsprozesse zwischen einer Praxis in die andere für die beteiligten Akteur*innen eröffnet, als auch verschiedene Ebenen der Reflexion einbezieht und verhandelbar macht.
AN: Dazu gehört auch das Forschungssetting. Wir haben im Seminar zum Zusammenleben der Lebensformen Formen kollaborativer Praxis zur Voraussetzung gemacht, sodass Form und Inhalt ineinandergreifen. Indem wir uns entlang von Lektüren über Theorien von Beziehungsweisen austauschten, wurde es gleichermaßen wichtig, uns auch die Beziehungsweisen, in denen wir als Personen im Seminar miteinander agieren, anzuschauen und einen gemeinsamen Code of Conduct zu etablieren. Das gemeinsame Tun im Lern- und Lehrraum der Hochschule, aber auch in der Schule, ist selbst schon das Moment, in dem sich eine informierte Haltung zeigt und befragbar wird.
SB: Die Philosophin und Künstlerin Bini Adamczak unterstreicht, dass es erst aus den Verknüpfungen unterschiedlicher Situierungen – ihren Beziehungsweisen – möglich wird, Handlungsmacht zu entwickeln (vgl. Adamczak 2017/2019: 255). Sie stellt heraus, dass ein Denken und Handeln in Beziehungsweisen dann politisch ist, wenn Gesellschaften als Zusammenschluss sozialer Relationen gedacht werden. Insbesondere wird den neoliberalen Strategien der Vereinzelung damit etwas gegenübergestellt, wie sie mit Margaret Thatchers Aussage unterstreicht: „There is no such thing as society. There are individual men and women and there are families“ (vgl. Adamczak/Sternfeld 2021: 80–81). Adamczak stellt mit der Hervorhebung von Beziehungsweisen einer Praxis des Zerschlagens von Beziehungen und Gesellschaftlichkeit ein Prinzip entgegen, dass die Sozialität des Lebens fokussiert und die Vielfalt sozialer Verbindungen in den Fokus rückt (vgl. ebd.). In diesem Sinne ist Reziprozität, verstanden als Gegenseitigkeit und Wechselseitigkeit, eine grundlegende Eigenschaft des Zusammenlebens. Reziprozität bezieht sich auf die Eigenschaft von Handlung, Beziehung oder Austausch, bei dem unterschiedliche Perspektiven und Akteur*innen gleichermaßen beteiligt sind und sich gegenseitig beeinflussen oder aufeinander reagieren.
AN: Im Kontext künstlerisch-edukativer Praxen bezieht sich Reziprozität vorrangig auf soziale Interaktionen und zwischenmenschliche Beziehungen, die aus der Zusammenarbeit hervorgehen. Hier schließt auch das Prinzip der Konvivialität im Sinne einer technik- und kapitalismuskritischen Selbstbegrenzung an. Diese wird angesichts ökologischer und klimatischer Krisen zur zentralen Voraussetzung einer Philosophie und Praxis des friedlichen, freundlichen Miteinanders auf der Ebene sozialer Beziehungen ebenso wie der Beziehung zur „Natur“, wie Les Convivialistes sie in ihrem konvivialistischen Manifest einfordern (Les Convivialistes 2014).
SB: Was meint das also im Kontext Schule? Donna Haraway spricht davon, sich verwandt zu machen (Haraway 2018) und relationales Denken in den Mittelpunkt zu stellen, um bestehende Wahrnehmungskonventionen zu stören und spekulative Fabulationen zu experimentieren. Für ein Zusammenleben unterschiedlicher Lebensformen könnte also zusammenfassend formuliert werden, dass die Entwicklung eines Bewusstseins der Ausgangspunkt dafür ist, in einen gemeinsamen Dialog zu treten, Beziehungsweisen wahrzunehmen und sie kollaborativ zu praktizieren. Eine künstlerisch-edukative Praxis vermag darauf aufmerksam zu machen, indem sie den Rhythmus unterbricht und neue Formen und Figuren des Miteinanders experimentiert.
2 In der Zusammenarbeit von Lehrpersonen, Künstler*innen, Schüler*innen und Kulturagent*innen im Modellprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen“ bilden sich Fragen ab um Verantwortung, Gegenseitigkeit, Praxis-Theorie-Verhältnis und hegemoniale sowie kapitalistische Widersprüche. Sie sind Ausgangspunkt für die Forschung mit der Konstruktivistischen Grounded Theory nach Kathy Charmaz. In der Praxis der Kulturagent*in reproduzieren sich die Widersprüche. Sie sind mit dem dringenden Wunsch verbunden, der in den Strukturen eingeschriebenen Gewalt Handlungsweisen entgegen zu setzen. Oder neutralisiert die Kulturagent*in mit ihrer Praxis die vielfältigen Überlagerungen eines unüberprüften Universalismus (vgl. Ballath 2024).
Adamczak, Bini (2017/2019): Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und kommende. 4. Auflage. Berlin: Suhrkamp.
Adamzcak, Bini/Sternfeld, Nora [mit Haas, Maximilian/Magauer, Hanna] (2021): Konvergenz der Zukünfte: Über widerstände Ästhetiken, imaginative Gegengeschichten und Institutionen als Beziehungsweisen, in: Haas, Annika/Haas, Maximilian/Magauer, Hanna/Pohl, Dennis (Hg.), How to relate, Wissen – Künste – Praktiken – Knowledge – Arts – Practices, Bielefeld: transcript, 79–94.
Ballath, Silke/Niemann, Annika (2025): Etwas verschiebt sich… Beziehungsweisen zwischen Praxis und Theorie künstlerisch-edukativer Interventionen im Kontext Schule. In: Kulturelle Bildung Online: https://doi.org/10.25529/pbh5-p259.
Ballath, Silke (2024): Kontextspezifische (Aushandlungs-)Räume pluraler Beziehungsweisen. Ethnographie künstlerisch-edukativer Prozess in einem Modellprogramm. München: kopaed.
Castro Varela, María do Mar/Haghighat, Leila (2023): Einleitung. Kritische Perspektiven auf Kunst und Kulturelle Bildung. In: dies. (Hg.): Double Bind postkolonial. Kritische Perspektiven auf Kunst und Kulturelle Bildung. Bielefeld: transcript, S. 11–24.
Freire, Paulo (1981): Der Lehrer ist Politiker und Künstler. Neue Texte zu befreiender Bildungsarbeit. Übersetzt von Horst Goldstein, Betty Olieira, Ilse Schimpf-Herken. Hamburg: Rowohlt.
Garcés, Marina (2022): Mit den Augen der Lernenden. Übersetzt von Richard Steurer-Boulard. Wien: Turia + Kant.
Haraway, Donna (2018): Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän, übersetzt von Karin Harrasser, Frankfurt/New York: Campus.
hooks, bell (1994): Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom, New York/London: Routledge.
Les Convivialistes (2014): Das konvivialistische Manifest. Für eine neue Kunst des Zusammenlebens, hg. von Frank Adloff und Claus Leggewie, übersetzt von Eva Moldenhauer, Bielefeld: transcript.
Santos, Juliana dos/Paula Souza, Thiago de (2021): Wer hat das Recht auf ein positives Imaginäres in Geschichte, Kunst und Erinnerung? Ein Gespräch über Bildung, Imagination und Geschichte in Brasilien. In: Diallo, Aïcha/Niemann, Annika/Shabafrouz, Miriam (Hg.): Untie to Tie. Koloniale Fragmente im Kontext Schule. Bonn: bpb, S. 72–80.
Spivak, Gayatri Chakravorty (2013): An Aestetic Education in the Era of Globalisation, Cambridge/Massachusetts/London (England): Harvard University Press.
Spivak, Gayatri Chakravorty (2008): Righting Wrongs – Unrecht richten, Berlin/Zürich: diaphanes.